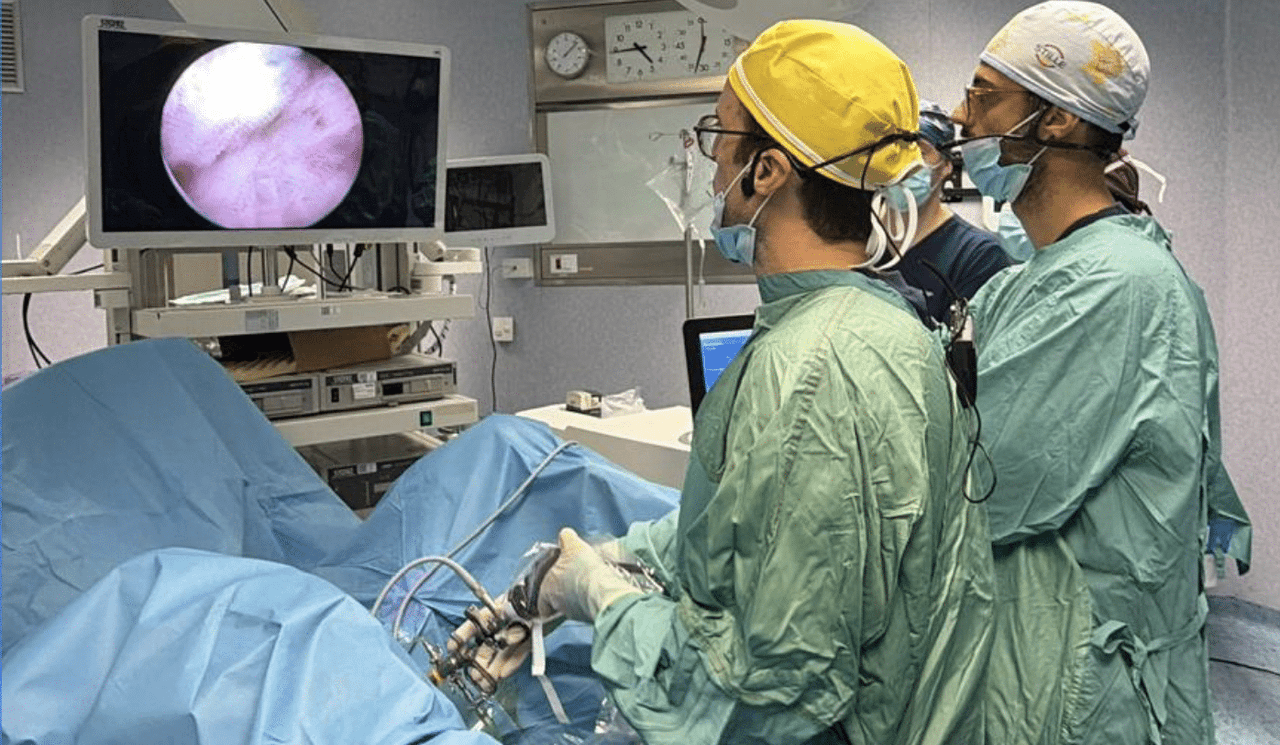Abschied von James Watson, Nobelpreisträger für die Entdeckung der DNA: Er wurde 97 Jahre alt.

James Dewey Watson, der amerikanische Biologe, Biochemiker und Genetiker, der zusammen mit Francis Crick die Doppelhelixstruktur der DNA entschlüsselte – einer der wichtigsten Meilensteine der Wissenschaftsgeschichte –, ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Er starb am Donnerstag, dem 6. November, in einem Hospiz auf Long Island, New York. Sein Sohn Duncan bestätigte die Nachricht gegenüber der New York Times und erklärte, Watson sei wegen einer Infektion ins Krankenhaus eingeliefert und anschließend in die Palliativpflege verlegt worden.
Die Entdeckung im Jahr 1953 ebnete den Weg für die moderne Genetik, Biotechnologie und Präzisionsmedizin. Für diese Arbeit teilten sich Watson und Crick 1962 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin mit Maurice Wilkins. Seitdem ist die Doppelhelix zu einem universellen Symbol geworden: zum Sinnbild des Lebens selbst.
Watsons Leben war jedoch nicht ohne Schattenseiten. Nachdem er das Cold Spring Harbor Laboratory zu einem der weltweit renommiertesten Forschungszentren ausgebaut hatte, musste er 2007 aufgrund rassistischer Äußerungen gegenüber der Londoner Sunday Times zurücktreten. Darin hatte er die Intelligenz von Menschen afrikanischer Abstammung infrage gestellt. Diese Kommentare lösten eine Welle internationaler Empörung aus und führten zum Entzug aller Ehrentitel des Labors, das er 25 Jahre lang geleitet hatte. „James hat in seinem Leben viele dumme Dinge gesagt. Das waren die schlimmsten“, kommentierte Bruce Stillman, sein Nachfolger an der Spitze des Forschungszentrums, damals.
Watson wurde 1928 in Chicago als Sohn eines Steuerbeamten und einer Universitätsangestellten geboren und zeigte frühreife Intelligenz: Mit 15 Jahren studierte er bereits. Nach seiner Promotion an der Indiana University unter der Betreuung des Nobelpreisträgers Salvador Luria zog er nach Cambridge, wo er Francis Crick kennenlernte.
1953 gelang es den beiden, auch dank unautorisierter Daten der Forscherin Rosalind Franklin, das Modell der DNA-Doppelhelix zu erstellen und so den Mechanismus aufzudecken, durch den genetische Information von einer Generation zur nächsten repliziert wird. Diese in Nature veröffentlichte Entdeckung veränderte die Biologie für immer.
Watson schilderte diese Leistung in dem berühmten Buch „Die Doppelhelix“, das 1968 erschien: eine brillante und polemische Autobiografie, die aufgrund ihres respektlosen Tons und Franklins sexistischer Beschreibungen Kollegen verärgerte. Das Buch wurde jedoch zu einem Klassiker der populärwissenschaftlichen Literatur und von der Library of Congress unter die 100 wichtigsten amerikanischen Bücher des 20. Jahrhunderts aufgenommen.
Nach dem Nobelpreis übte Watson weiterhin enormen Einfluss auf die zeitgenössische Wissenschaft aus. 1989 wurde er der erste Direktor des Humangenomprojekts, jenes gigantischen internationalen Vorhabens, das im Jahr 2000 zur vollständigen Kartierung des menschlichen Genoms führte. „Er war gegen die Idee, das ‚Buch des Lebens‘ patentieren zu lassen“, erinnerte sich Stillman. Eine Position, die der Oberste Gerichtshof der USA 2013 bestätigte und entschied, dass natürlich vorkommende Gene nicht patentiert werden können.
Groß, schlaksig und stets etwas zerzaust, wurde Watson von Kollegen und Studenten als brillant und schwierig beschrieben, fähig zu brillanten Erkenntnissen und verstörenden Äußerungen. Der Biologe E.O. Wilson nannte ihn den „Caligula der Biologie“. 2014 versteigerte er seine Nobelpreismedaille und erklärte, er fühle sich von der wissenschaftlichen Gemeinschaft „ausgestoßen“. Sie wurde für über vier Millionen Dollar vom russischen Tycoon Alischer Usmanow ersteigert, der sie ihm später zurückgab.
Trotz aller Kontroversen und Rückschläge bleibt James Watsons Name untrennbar mit der Entdeckung der DNA, dem „Geheimnis des Lebens“, verbunden. Ein Vermächtnis, das keine Kontroverse auslöschen kann. (von Paolo Martini)
Adnkronos International (AKI)